|
|
|
|
|
|
|
Kindskopf - Eine Heimsuchung | Rezensionen und Empfehlungen (Auswahl) |
|
|
|
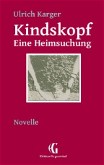 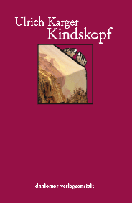
(Soweit nicht extra gekennzeichnet, beziehen sich die Rezensionen auf die Erstausgabe)
Ulrich Karger und der deutsche Süden - eine unerhörte Begebenheit! Nichts für postmoderne Kindsköpfe.“ Klaas Huizing; für den Klappentext 2002 Prof. Dr. Dr. Klaas Huizing, Ordinarius am Lehrstuhl für Systematische Theologie an der Universität Würzburg, hat sich neben dem Verfassen veritabler Fachbücher auch als Romancier einen Namen gemacht, u.a. mit "Der Buchtrinker" (1994), "Das Ding an sich" (1998), "Das Buch Ruth" (2000), "Auf Dienstreise" (2000). Die Parallelität zur Bibelgeschichte Jona ist unumstößlich und hervorragend in die Erzählung eingebunden. (..) Gottkritisch begleitet Jonas den Leser durch dessen Vergangenheit und lässt dabei das Zwerchfell in Bewegung kommen. (..) Eine Novelle mit ganz besonderem Charakter – und Charakter im Sinne von Protagonist. Mögen sich hauptsächlich Erwachsene aus dargestellter Zeit in dem Buch wiederfinden, ist der Kindskopf auch heute noch Programm. Wenn auch in anderem Maße. Ein Buch für interpretationsfreudige Leser und Kindsköpfe, die es einmal waren oder heute noch sind.“ Tina Klein zur Neuausgabe 2012 alliteratus.com; 21. August 2012 (Die mit fünf ***** das Buch als „herausragendes literarisches Werk“ und „ein Muss!“ gekennzeichnete Rezension kann unter alliteratus.com hier vollständig als Pdf-Datei abgerufen werden) Helmut Ruppel Berlin-Brandenburgisches Sonntagsblatt Nr. 30; 21. Juli 2002 Jonas Brandeiser flieht ans Ende der Welt, das liegt irgendwo in Bayern, heißt es im Umschlagtext. Legt man beides, Kargers Kindskopf und den biblischen Jona, nebeneinander, dann erfährt man viel über Motive und Handeln des Menschen in der postmodernen Gesellschaft, vielleicht auch über sich selber! Die Sündhaftigkeit Ninives wird im Kindskopf durch die Stimmungslage und Mentalität der im Kalten Krieg groß gewordenen (Spät-) 68er repräsentiert: Politische Weltsicht wird auf einmal ganz privat, wenn der moderne Jonas Brandeiser dem Kinderwunsch seiner Freundin entgegensetzt, dass man in diese schreckliche Welt keine Kinder hineinsetzen darf. Der Sündenfall der Generation um Jonas Brandeiser besteht nun darin, dass die politische Dimension schrittweise verdunstet und nur noch das Private - und letztlich Kleinbürgerliche! - bleibt: Jonas flieht vor der Frau; außerdem fehlt das nötige Kleingeld für ein neues Taxi, sodass er sich auch finanziell kein Kind leisten kann! Bei der Lektüre drängen sich weitere Assoziationen auf: Kinderlosigkeit oder - wenn überhaupt - Kleinstfamilie als die größte Sünde unserer Gesellschaft? Das wäre bereits eine recht prophetische Sicht! Und: Die Frau als Gott des Mannes, die ihn zur Flucht zwingt und am Ende doch siegt? Jedenfalls: Im Vergleich zum biblischen Jona hat Jonas Brandeiser keine globale religiös-moralische Aufgabe, vor der er flieht. Sein Motiv ist letztlich rein persönlich. Individualismus pur. Konsequent: Die Reise ans Ende der Welt reicht, vom Erzähler selbst so gedeutet, einmal um den Erdball (nun ja: immerhin von Berlin nach Bayern) und zurück zu sich selbst. Der Omphalus ist das eigene Selbst. Insofern führt die Flucht nicht durch den Walfisch, sondern in den Walfisch - in den Uterus der eigenen Lebensgeschichte, die in einer eindrucksvollen Milieustudie zur Kindheit und Jugend des Jonas Brandeiser geschildert wird. Dieser Walfisch lässt Jonas das ganze Leben nicht los, der Lebertran ist seine Muttermilch. Kennzeichen einer Generation, die nostalgisch-schweigend von Startbahn West, Mutlangen und Wackersdorf erzählt - in der Selbsterfahrungsgruppe oder auf der Couch des Psychiaters. Jonas Brandeiser rettet die Höhle seiner Kindheit ins moderne Ninive zurück - eine grandiose Schluss-Szene! Und kaum streckt er sich unter seinem Rizinus-Strauch aus, kommt die Göttin, knabbert an den brüchig gewordenen Lebenswurzeln und siegt. Man muss das Buch mit viel Selbstironie lesen! Wenn man einem literarischen Werk dann auch noch ein diskussionswürdiges Zitat für eine Klausur entnehmen kann (Es dauert noch einige Jahre, bis die evangelische und die katholische Volksschule in einer konfessions-unabhängigen Grundschule aufgehen würden, S. 41), hat es seinen Bildungszweck mehr als eingelöst. Ein empfehlenswertes Buch für alle, die auf unterhaltsame Weise neue Zugänge zu einer vertrauten Geschichte erhalten möchten und für die beides - biblischer Text und Kargers Kindskopf - zum Resonanzraum für eigene lebensgeschichtliche Erfahrungen werden kann.“ Prof. Dr. Hans Mendl Katechetische Blätter 4/2005; Juli 2005; Anders lernen, S 311 / Auslese Dr. Claudia Puschmann Ev. Welt - Diese Woche Nr. 23; 02.06.02 Marion Rockenbrod Literatour Nr. 12; Beilage des Luxemburger Tageblatt; 23.04.2003 Die Sündhaftigkeit Ninives wird in Kindskopf durch die Stimmung im Kalten-Krieg-geprägten Deutschland repräsentiert: Man könnte nicht sagen, welche Sünde größer ist: das ubiquitäre politische Bedrohungspotential oder die rein egozentrische Angst davor. Politische Weltsicht wird ganz privat, wenn Jonas Brandeiser folgert: In diese Welt darf man keine Kinder hineinsetzen! Der Sündenfall der Generation um Brandeiser besteht nun darin, dass die politische Dimension schrittweise verdunstet und nur noch das Private bleibt: ich fliehe vor meiner Frau, die ein Kind von mir will, und schließlich fehlt das nötige Kleingeld für ein neues Taxi! Zwei weitere Assoziationen drängen sich auf: Kinderlosigkeit oder - wenn überhaupt - Kleinstfamilie - die größte Sünde unserer Gesellschaft? Das wäre bereits eine recht prophetische Sicht! Die Frau als Gott des Mannes, die zur Flucht zwingt und am Ende doch siegt? Jedenfalls: Im Vergleich zum biblischen Jona hat Jonas Brandeiser keine globale religiös- moralische Aufgabe, vor der er flieht, sondern eine letztlich rein persönliche. Individualismus pur. Konsequent: Die Reise ans Ende der Welt führt, vom Erzähler so auch knapp grandios gedeutet, einmal um den Erdball und zurück zu sich selbst. Der Omphalus ist das eigene Selbst. Insofern führt die Flucht nicht durch den Walfisch, sondern in den Walfisch - in den Uterus der eigenen Lebensgeschichte, die in einer eindrucksvollen Milieustudie geschildert wird. Dieser Walfisch lässt Jonas das ganze Leben nicht los, der Lebertran ist seine Muttermilch. Kennzeichen einer Generation, die nostalgisch schwelgend von Startbahn West, Mutlangen und Wackersdorf erzählt - in der Selbsterfahrungsgruppe oder auf der Couch des Psychiaters. Jonas Brandeiser rettet die Höhle seiner Kindheit ins moderne Ninive zurück. Und kaum streckt er sich unter seinem Rizinus-Strauch aus, kommt die Göttin, knabbert an den brüchige gewordenen Lebenswurzeln und siegt.“ Prof. Dr. Hans Mendl Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts Universität Passau; Januar 2003 Wem das nur "irgendwie" bekannt vorkommt, für den hat Ulrich Karger in zwei kleinen Einschüben die vier alttestamentlichen Jona-"Bücher" zwischen seine vier Kapitel "Kindskopf" gesetzt. Sie korrespondieren keineswegs nur in formaler Hinsicht mit dieser sehr heutigen und vieldeutigen "Heimsuchung" des Jonas Brandeiser. So fällt dessen Flucht nicht von ungefähr gerade auf den 3.10.1990, und der bis zuletzt namenlos bleibende Geburtsort wird zum Synonym heimatlicher Hassliebe - eine deutsch-bayerische Vergangenheitsanmutung, die nie so tut, als wäre da etwas zu "bewältigen". Doch entgegen seiner vor sich her getragenen rationalen Weltsicht, muss Jonas noch immer gegen den von den Eltern oktroyierten, alles möglich machenden Gott ankämpfen. Im Bauch des Tisches mit seinen Kindheiterinnerungen konfrontiert, meint er jedoch gegen IHN leichtes Spiel zu haben. Denn was hierbei wegen seines offengelegten Aberwitzes oft genug das Zwerchfell reizt, lässt einem angesichts der nicht zu übersehenden Tragik gleichzeitig den Atem stocken. Gerade weil es nicht larmoyant und moralinsauer daherkommt. Wie Karger allein schon dieses zweite, im Original eigentlich nur drei Sätze umfassende Jona-Buch mit dem (Er-)Leben bayerischer Herkunft füllt und daraus dann einen bestechenden wie überzeugenden Übergang für die beiden nachfolgenden Kapitel in Berlin findet, beweist neben der kenntnisreich souveränen Aneignung der Vorlage hohen Einfallsreichtum und großes Sprachvermögen. Sowenig sein Jonas letztlich die Präsenz Gottes als ein allem menschlichen Wollen übergeordnetes Drittes anzweifeln kann, so heftig bestreitet er nach Art der Psalmisten das klaglose Hinnehmen Seines Willens. Karger hat damit ein heftig gegen den Strich gebürstetes Stück Literatur entwickelt, das weit über die Zugehörigkeit irgendeiner Glaubensgemeinschaft hinauszuweisen vermag. Und das ist schon wirklich außergewöhnlich.“ Gerd Perlhuhn Religion heute Nr. 50; Juni 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|